Unser Gastautor Eren Özbek besucht eine Kleinstadt an der türkisch-syrischen Grenze, die mehr Flüchtlinge aufnimmt als sie Einwohner hat. Er ist begeistert von kommunaler und internationaler Solidarität, die dort gerade in der schwierigen Situation gelebt wird:
Suruç ist eine kleine Stadt in der türkischen Provinz Urfa mit etwa 100.000 Einwohnern, deren größter Teil kurdischer Abstammung ist. Seit den Angriffen des IS auf das in Syrien liegende Kobane hat Suruç einen immensen Wandel erlebt: Etwa 200.000 Flüchtlinge sind über die Grenze gekommen und haben Schutz gesucht.
Eine Mammutaufgabe für eine Kleinstadt. Ein Kulturzentrum an der einzigen Hauptstraße dient jetzt als Hauptquartier für Freiwillige. Sie kommen aus dem Umland, aber auch aus den westtürkischen Städten wie Izmir oder Istanbul und aus dem internationalen Ausland.
Amara heißt dieses Zentrum. Kaum setzt man seinen Fuß hinein, fühlt man sich im Pausenraum einer UN-Versammlung: Spanische Aktivisten diskutieren passioniert während zwei koreanische Aktivistinnen plaudernd die Treppen runterkommen. Ein mit französischem Akzent gesprochenes Englisch ruft durch den Vorraum und wird mit US-Akzent erwidert. Eine UN-Versammlung ohne Anzug, ohne Krawatten, ohne sinnloses Protokoll. Alle sind gleich beschmutzt mit dem Schlamm, der hier fast alle bedeckt. Heftige Regengüsse und Unwetter haben alle Textilien und Schuhe gleichgestellt.
Kurdisch, Arabisch und Türkisch verschmelzen in diesem angenehmen Chaos an Sprachen. Menschen mit Zetteln kommen und gehen. Ein fast geordnetes und selbstverständliches Getümmel. Meine Begleitung, die in Gaziantep für eine internationale Hilfsorganisation arbeitet, hat ihre Freundin am anderen Ende des Handys. Sie bittet uns nach oben in das erste Stockwerk.
„Kaum eine internationale Organisation kümmert sich um die etwa 200.000 Flüchtlinge, die in Suruç untergekommen sind“ erklärt sie mir. Der staatliche türkische Katastrophenschutz „AFAD“ hat zwar seine Camps hier. Doch viele Familien, die dort untergekommen sind, wollen raus aus diesen Lagern.
Auf meine fragenden Blicke hin erklärt sie mir die Gründe: Syrischen Kurden sei es nicht gestattet sich frei zu bewegen und das Camp zu verlassen, während syrische Araber und andere Gruppen, die eher in Urfa und Gaziantep Zuflucht gefunden haben, sogar eine Arbeitserlaubnis bekommen. „Auch wird ihnen aufgezwungen entweder Arabisch, die offizielle Landessprache Syriens, oder Türkisch zu sprechen“. Deshalb fliehen die Flüchtlinge noch einmal in die Lager der Stadtverwaltung, in der die kurdisch-sozialistische Partei DBP die Regierung stellt. „Hier gibt es keinen Sprachenzwang, es gibt Bewegungsfreiheit und Solidarität“ bestätigt uns die Aktivistin Evrim, die sich gerade von einem amerikanischen Freelance-Regisseur verabschiedet hat.
Zusammen fahren wir zu einem der Flüchtlingscamps. In zwei Wagen geht es entlang der Grenze von Kobane zu einem Lager, das gerade ausgebaut wird. „Du kannst gleich mithelfen und Zelte aufstellen, denn wir erwarten 700 Familien, die schnellstens Zelte benötigen“ sagt mir Evrim als wir einem anderen Freiwilligen folgen, der uns zum Lager führen wird.
Kaum eine Stunde nach unserer Ankunft hören wir schweres Geschütz und Bomben, die in Kobane einschlagen. Ob es alliierte Bomber sind oder ISIS-Angriffe kann man nicht sofort unterscheiden. Aber diejenigen, die diese Art von „Lärm“ gewohnt sind und solche wie mich, die besorgt und erschrocken zusammenzucken.
Keine Fahne der bekannten Hilfsorganisationen ist weit und breit zu sehen. Kein Rotes Kreuz, keine UN-Fahne, Welthungerhilfe oder die Embleme sonstiger Organisationen, die man eigentlich jetzt hier erwarten würde. Zu sehr fürchten sie den Eingriff der konservativen Regierung, die es nicht zulässt Lorbeeren für Hilfestellung zu teilen.
Deshalb basiert alles auf freiwilliger Arbeit und der Hilfe von Stadtverwaltungen, die Bürgermeister/innen der kurdischen Partei haben. Auch verschiedene Vereine, linke Organisationen sowie oppositionelle Verbände schicken Hilfe in diese Region, in der der Krieg im Nachbarland tiefe Spuren hinterlassen hat. Kommunale Hilfe und Selbstverwaltung sind das Stichwort hier. Jeder hilft mit, wie auch nur möglich.
Angekommen im Lager öffnen sich die Tore und eine Schar von Kindern empfängt uns mit neugierigen Augen. Auch ein Bus aus Istanbul, der Mitglieder der Frauen der HDK (Demokratischen Kongress der Völker) parkt im Lager. Sie haben Hilfsgüter aus Istanbul gebracht. Schnell bilden sich Menschenketten vom Bus zu verschiedenen Depots. Kanister mit Speiseöl, Säcke voller Linsen und Nudelpakete werden von Hand zu Hand gereicht. Niemand scheut sich vor der Arbeit.
Nach kurzer Zeit ist alles verstaut und ein Aufruf wird gemacht: es müssen Zelte aufgestellt werden. Während einige die Zelte, Stangen und Heringe abstellen, machen sich erfahrene Lagerhelfer an die Arbeit und erklären uns Neulingen wie man sie aufbaut. Schnell bilden sich Gruppen von Frauen und Männern, die schweres Material schleppen, auslegen und dann große Zelte aufbauen. Wehe man bietet einer Frau an, etwas Schweres abzunehmen. In diesem Moment wäre man wohl sicherer im Kampfgebiet von Kobane! Alle sind gleich und jeder hilft soweit er oder sie kann. Trotz eisigem Wind wird bis in den Abend gearbeitet. Jedes Zelt bietet bis zu drei Familien eine Unterkunft.
Lehrer aus Izmir, Studentinnen aus Istanbul und Rentner aus Mardin packen mit an wo es nur geht. Anarchisten und Sozialisten plaudern über Bakunin und Lenin ohne Feindschaft, Kommunisten und Umweltaktivisten diskutieren während dem Zelte aufbauen über den Wiederaufbau von Kobane. In Suruç sind keine Rivalitäten zu spüren und hunderten von Kindern vergeht trotz allem und dem ganzen Leid das Lachen nicht.
Es hört sich zwar vielleicht alt-romantisch an, aber ich habe durch und durch nur ein Gefühl:
Es entsteht eine neue Gesellschaft aus der Asche Kobanes.
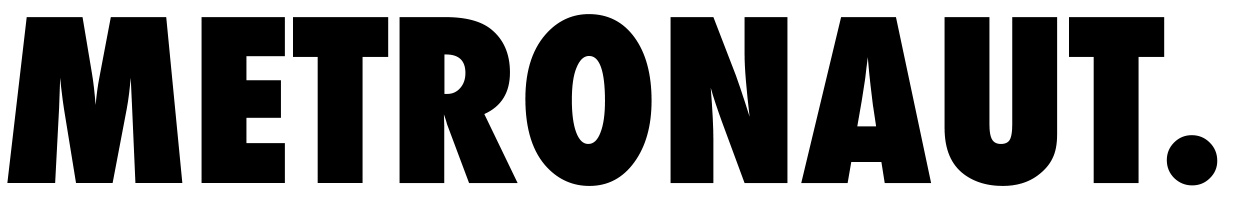




Ein wunderbarer Artikel und wegen des Inghalts des letzten Satzes haben wir eine Initiative gegründet, die Kobane unterstützen soll bei dem Vorhaben eine neue Gesellschaftsordnung zu bauen.
http://www.schule-kobane.de/