Ein Gastbeitrag von Lou Huber-Eustachi, die sich seit Tagen in Idomeni aufhält.
Der Versuch einer Klärung: Nicht „Gerüchte“ bringen Flüchtende dazu – wenn auch aussichtslose – Versuche zu unternehmen, bei Idomeni die Mazedonische Grenze zu überwinden, sondern die unwürdigen Bedingungen, in die sie von der Europäischen Union gezwungen werden. Das Problem ist nicht Naivität, sondern die pure Abstinenz von Perspektiven.
Durch die deutschen Medien geisterte am Sonntag die Nachricht, „Unbekannte“ hätten bei den Flüchtenden in Idomeni und den umliegenden Lagern aus „unbekannten Gründen“ die Hoffnung geweckt, dass sich die Grenze nach Mazedonien am Sonntag für die Flüchtenden öffnen werde. Außerdem würden ihnen bei ihrer Grenzüberquerung das Rote Kreuz sowie 500 Journalist*innen beistehen.
Die Texte ähneln sich bei den verschiedenen Artikeln von zum Beispiel der taz, der Deutschen Welle und der Zeit zum Teil sehr stark, vermutlich haben alle Zeitungen die gleiche Agenturmeldung als Grundlage. Bezogen wird sich dabei immer wieder auf zwei Flüchtende, einer sagte dem griechischen Rundfunk „Wir haben gehört, die Grenze geht heute auf“ und ein weiterer Syrer, dessen Schwester von der angeblichen Grenzöffnung im Internet gelesen und ihn daraufhin informiert hatte.
Gemutmaßt wird außerdem, dass die Äußerungen des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, Thüringen könne bis zu 2000 Flüchtende aus Idomeni aufnehmen, einer der Auslöser für die Gerüchte über die Grenzöffnung im Camp sein könnte.
Die Menschen in Idomeni wissen, was sie wollen
Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, Flüchtende nur als verzweifelte Opfer zu sehen, dass wir glauben ein „von außen stammendes Gerücht“ sei nötig, um die Menschen zu aktiven Handlungen zu bewegen – wie es die „Zeit“ in ihrem Artikel impliziert, wenn sie schreibt: „Bereits am Samstag hatten Unbekannte in dem Lager das Gerücht verbreitet, Deutschland werde Tausende Schutzsuchende aus dem Flüchtlingslager aufnehmen.“
Klar ist, dass das Camp voller Gerüchte ist. Das Problem ist dabei auch der gravierende Mangel an Struktur zur Informationsvermittlung und angemessener Übersetzung.
Doch eigentlich geht es um etwas anderes. Die Menschen in Idomeni wissen, was sie wollen. Sie möchten an einem Ort ankommen, wo das permanente Warten ein Ende hat. Einem Ort, wo nicht nur die medizinische Versorgung und der Zugang zu ausreichend Essen und Trinkwasser sichergestellt ist, sondern irgendwo, wo der dauerhaften Ausnahmezustand endlich ein Ende hat. Wo sie etwa mit ihren Familien ein angemessenes Ausmaß an Privatsphäre genießen und wo ihre Kinder zur Schule gehen können. Ein Ort, an dem sie nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, wo sie Feste feiern und sich selbst organisieren und versorgen können. Der Satz „I just want a normal life“ ist ein vielgehörter für diejenigen, die sich ernsthaft mit den Menschen in Idomeni und anderswo auseinandersetzen.
Oft wird als Ziel Deutschland genannt, zum einen weil viele Menschen dort gute Chancen für sich auf Asyl oder eine Arbeit sehen, aber oft auch, weil hier bereits Familienmitglieder von ihnen leben.
Die Gerüchte über die Grenzöffnung sind gewiss nicht nicht einfach von „außen“, von „Unbekannten“, böswillig ins Camp geschmuggelt worden.
Viele Flüchtende sehen angesichts der ihnen von Seiten der EU aufgezwungenen Perspektivlosigkeit keine andere Möglichkeit, als weiter zu versuchen, die europäischen Grenzen zu überwinden. Sei es durch den direkten physischen Gang Richtung Zaun, oder durch das Verharren im Camp, den Versuch durch ihre Anwesenheit gegen das Vergessenwerden anzukämpfen und, im Extremfall, auch durch Selbstanzündungen – denn vielleicht führen noch drastischere Bilder ja endlich irgendwann zu drastischen Veränderungen.
Keine stummen Opfer
Die Menschen, die sich derzeit in Idomeni aufhalten, sind nicht einfach stumme Opfer. Sie sind Menschen, die sich auf einen Weg voller Strapazen gemacht haben, die den Antrieb haben, ihr Leben zu gestalten und es für sie lebenswert zu machen. Sie sind Betroffene der menschenverachtenden Politik einer Festung Europa, die sich nicht einig wird und damit Tausende in absoluter Ungewissheit im Schlamm ersticken lässt. Sie sind die Betroffenen einer Berichterstattung, die über ihre aktiven Schritte präferiert dann berichtet, wenn sie sich mit Beiwörtern wie „agressiv“ oder „verzweifelt“ schmücken lassen. Diesen Menschen werden keine Perspektiven aufgezeigt, welche ein „normal life“ beinhalten. Und diese Menschen müssen sich ihren Antrieb, ihre Hoffnungen oft selber erhalten und bewahren.
So kann es passieren, dass die Erzählung von Protesten der Menschen in Deutschland gegen die Dichtmachung der Grenzen, oder über die Ideen eines Bodo Ramelow sich im Camp über den Flüsterpost-Effekt zu angeblichen Fakten wandelt. Es gibt auch keinen zentralen Ort, wo sich die Menschen treffen und diskutieren, wo sie Wissen austauschen und sich vernetzen können. Keine strukturierte Kommunikation. Viel mehr sind die meisten von Ihnen oft mehrere Stunden täglich damit beschäftigt, für Essen oder Kleidung anzustehen. Aber gleichzeitig teilen Unterstützer*innen in Idomeni auch immer wieder ihre Einschätzung mit den Flüchtenden, dass sich die Grenze nach Mazedonien nicht öffnen wird. Auch diese Information wird im Camp von Mund zu Mund weitergetragen.
Dass die Menschen wieder einmal vor dem Zaun standen, ist nicht einfach das naive Ergebnis unbedarfter Gutgläubigkeit.
Es ist, was eine Festung hervorbringt: Vergessene, Ungewollte, Ausgeschlossene, die sich aktiv ihre Wege und Schlupflöcher suchen, um endlich Einlass zu finden.
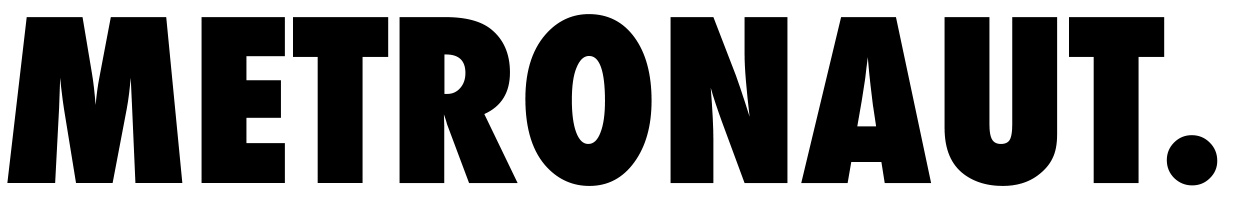



Die Formulierung „Abstinenz von Perspektiven“ im ersten Absatz halte ich für gänzlich falsch. Abstinenz bedeutet freiwilliger Verzicht. Das ist es ja ganz bestimmt sicherlich nicht.